
Die prähistorische Evolution... ca. 4400 bis 3500 v. Chr.
Jungneolithikum
Das Jungneolithikum – ein faszinierender Abschnitt der Jungsteinzeit in Mitteleuropa, der sich von etwa 4400 bis 3500 v. Chr. erstreckt – markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der prähistorischen Entwicklung. In dieser Epoche werden erstmals Kupfergegenstände in den südöstlichen Regionen sichtbar, was den Übergang in die sogenannte Kupfersteinzeit einläutete – auch unter den Bezeichnungen Chalkolithikum oder Aeneolithikum bekannt. Erheblich prägten dabei zwei kulturelle Strömungen die damalige Lebensweise: Einerseits die einflussreiche Lengyelkultur aus dem südöstlichen Mitteleuropa, deren innovative Ansätze tiefgreifende Auswirkungen hatten, und andererseits die weitreichenden Megalithkulturen Westeuropas, die mit ihren monumentalen Bauwerken beeindruckten. Zudem kam es bereits im 5. Jahrtausend v. Chr. südlich der Alpen zur Entstehung erster Pfahlbaukulturen, deren einzigartige Bauweise einen bedeutenden Impuls für die spätere archäologische Siedlungsentwicklung gab.

Gliederung des Neolithikums
Wie regionale Einflüsse die Einteilung des Neolithikums in Deutschland prägen
Die Einteilung des Neolithikums beruht maßgeblich auf einer von Jens Lüning entwickelten Fünf-Stufen-Gliederung, die in Deutschland weit verbreitet ist. Dieser Ansatz baut unmittelbar auf das Mittelneolithikum auf und unterteilt die gesamte Jungsteinzeit in die Phasen Frühneolithikum, Mittelneolithikum, Jungneolithikum, Spätneolithikum und Endneolithikum. Innerhalb dieser Systematik werden die Abschnitte Jung-, Spät- und Endneolithikum häufig unter dem Sammelbegriff Kupfersteinzeit zusammengefasst – ein Hinweis auf die zunehmende Relevanz von Schmuckstücken und Waffen, die bereits aus Kupfer gefertigt wurden.
Regionale Differenzen in der Terminologie
Die Bezeichnungen und Einteilungen des Neolithikums variieren jedoch regional in Deutschland. In Mitteldeutschland – speziell in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – wurde traditionell ein dreistufiges System verwendet. Bereits 1951 schlug Ulrich Fischer vor, die Epoche in Früh-, Hoch- und Spätneolithikum zu gliedern. Spätere Ansätze, wie der von Hermann Behrens, favorisierten eine Unterteilung in Früh-, Mittel- und Spätneolithikum, wobei hierbei die Jordansmühler Kultur und die Gaterslebener Kultur an der Schwelle zwischen Früh- und Mittelneolithikum verortet wurden. Mit der Zeit wurde auch für Mitteldeutschland ein Modell mit vier Abschnitten entwickelt, das das Jungneolithikum einschloss und so eine Angleichung an die südwestdeutsche Chronologie anstrebte. Die anschließende Kalibrierung der Radiokohlenstoffdaten zeigte jedoch, dass die Epoche des Jungneolithikums absolut zeitlich weitaus länger dauerte als die anderen drei Stufen. Dies veranlasste Jens Lüning, das System auf eine Fünffachgliederung auszudehnen. Diese umfassende Einteilung dient als Versuch, das mitteleuropäische Chronologiesystem zu vereinheitlichen und spiegelt zugleich wesentliche Umbrüche in der kulturellen Entwicklung wider. Gemäß dieser Fünffachgliederung werden die nachfolgend genannten Kulturen dem Jungneolithikum zugeordnet.
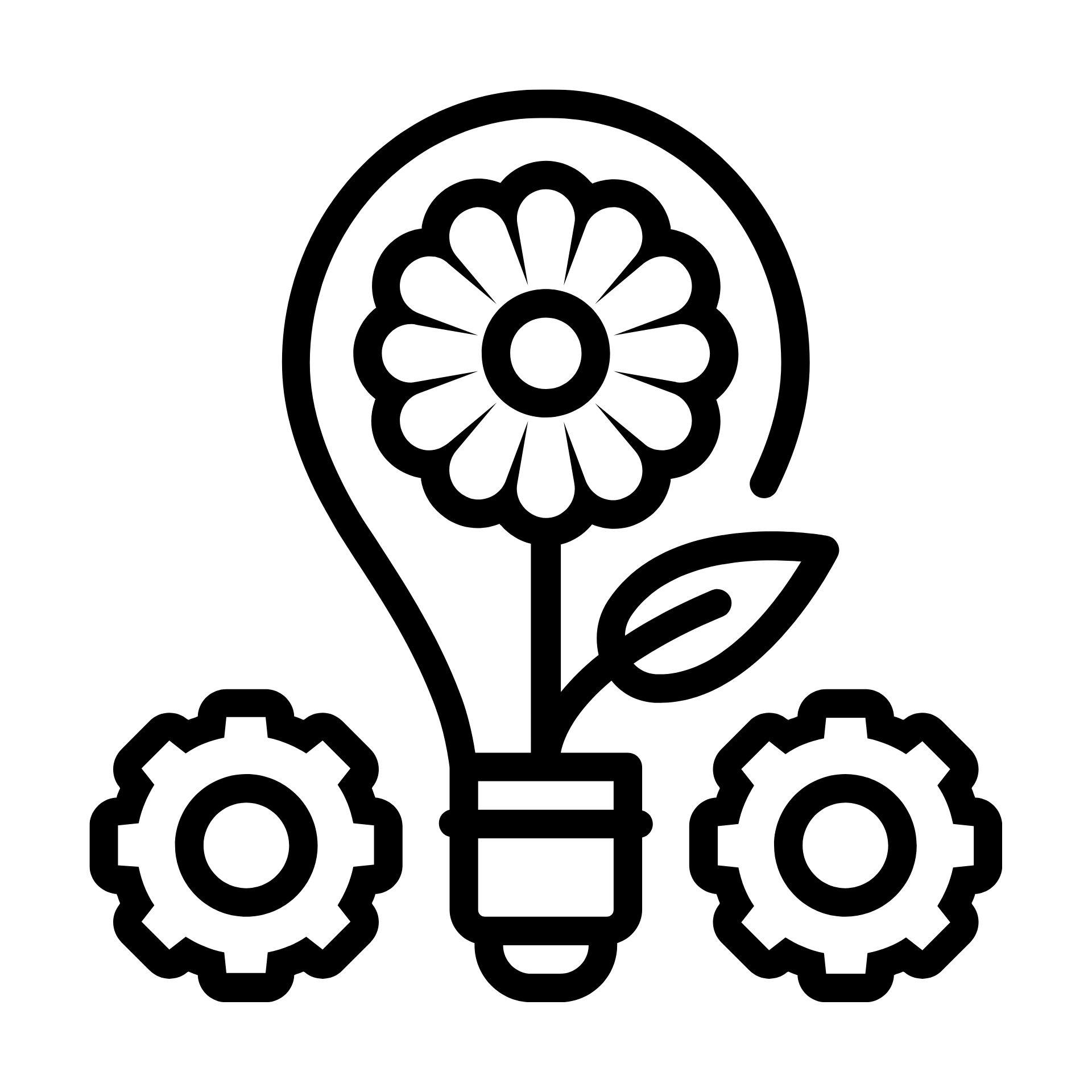
Erfindungen des Jungneolithikums
Innovative Durchbrüche, die die prähistorische Welt revolutionierten
Rind als Zugtier und Ochsenkarren
Im Jungneolithikum setzten die Menschen erstmals das Rind verstärkt als Arbeitstier ein. Dadurch wurde der Bau und Einsatz von Ochsenkarren mit clever konstruierten Starrachsen und praktischen Scheibenrädern möglich – ein Meilenstein, der den Transport von Gütern und den Austausch zwischen Siedlungen erheblich vereinfachte.
Hakenpflug
Bereits in der Bandkeramik fanden erste Ansätze des Hakenpflugs Anwendung, doch im Jungneolithikum wurde dieser Pflug weiter verfeinert. Die Innovation ermöglichte eine effektivere Bodenbearbeitung und legte damit den Grundstein für eine produktivere Landwirtschaft.
Grünland-Weidewirtschaft
Die systematische Nutzung von Grünland als Weide trug wesentlich zur Optimierung der Viehzucht bei. Diese Methode sorgte für eine nachhaltige Beweidung und bot den Bauern eine zuverlässige Basis, um ihre Herden effizient zu versorgen.
Bohlenwege
Mit der Errichtung von Bohlenwegen, robust zusammengelegten Pfaden aus Holz, wurde eine neue Art der Infrastruktur geschaffen. Diese Wege erleichterten nicht nur den Transport, sondern förderten auch den kulturellen Austausch zwischen den prähistorischen Gemeinschaften.
Domestizierung des Pferdes
Obwohl das Pferd noch nicht als Reitpferd genutzt wurde, begann im Jungneolithikum die Domestizierung dieser Tiere. Die frühe Integration des Pferdes als Arbeitstier eröffnete neue Perspektiven in Bezug auf Mobilität und den Transport schwerer Lasten.
Metallurgie
Ein weiterer bedeutender Fortschritt war die Entwicklung der Metallverarbeitung. Erste metallurgische Techniken ebneten den Weg für die spätere Nutzung von Kupfer, was letztlich die kulturelle Entwicklung in der gesamten Epoche maßgeblich beeinflusste.
Kleinhäuser
Im Gegensatz zu den imposanten Großbauten des Früh- und Mittelneolithikums setzten die Menschen nun verstärkt auf den Bau von Kleinhäusern. Diese dezentralen Siedlungen spiegelten eine flexible und anpassungsfähige Lebensweise wider und markierten einen deutlichen sozialen Wandel.
Megalithik
Die Epoche erlebte auch eine Blütezeit der Megalithik. Monumentale Steinkonstruktionen, die bis heute faszinieren, zeugen von der außergewöhnlichen Baukunst und dem tief verwurzelten kulturellen Bewusstsein jener Zeit.
Feuchtbodensiedlungen
Nicht zuletzt entwickelten sich spezielle Feuchtbodensiedlungen in feuchten Umgebungen. Die Bewohner passten sich den herausfordernden Bedingungen an und perfektionierten Techniken, um in wasserreichen Landschaften erfolgreich zu leben und zu wirtschaften.
Jungneolithikum
STECKBRIEF
01
Name
Jungneolithikum
02
Alter
Etwa 4400 bis 3500 v. Chr.
03
Epoche
Ein Abschnitt der Jungsteinzeit (Neolithikum) in Mitteleuropa.
04
Charakteristische Merkmale
- Erster systematischer Einsatz von Kupfergegenständen.
- Übergang in die sogenannte Kupfersteinzeit (auch Chalkolithikum bzw. Aeneolithikum).
05
Kulturelle Einflüsse
- Lengyelkultur: Einflussreiche Kultur aus dem südöstlichen Mitteleuropa.
- Megalithkulturen: Prägende Gruppen in Westeuropa, bekannt für monumentale Bauwerke.
06
Regionale Besonderheiten
Südlich der Alpen bildeten sich im 5. Jahrtausend v. Chr. erste Pfahlbaukulturen heraus, die für die spätere archäologische Siedlungsentwicklung bedeutsam waren.
07
Bedeutung
Markiert einen Wendepunkt in der prähistorischen Entwicklung Mitteleuropas, in dem technologische Innovationen und kulturelle Austauschprozesse deutlich an Bedeutung gewannen.
Archäologische Kulturen des Jungneolithikums in Mitteleuropa
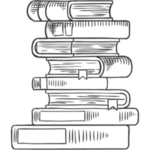
Literatur
- Jens Lüning: Erneute Gedanken zur Benennung der neolithischen Perioden. In: Germania. Band 74/1, 1996, S. 233–237 (Online).
- Ulrich Fischer, Zu den mitteldeutschen Tontrommeln. Archaeologica Geographica 1, S. 98–105
- Ulrich Fischer, Über Nachbestattungen im Neolithikum von Sachsen-Thüringen. Festschrift RGZM Mainz Bd. 3, S. 161–181
- Hermann Behrens: Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet (= Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Band 27). Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1973.
- Ulrich Fischer, Gedanken zur Benennung der urgeschichtlichen Perioden. Fundberichte Hessen 14, 1974.
- Ulrich Fischer, Ein Chronologiesystem im Neolithikum. Germania 54, 1976. S. 182–184












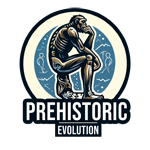
Wonderful site. Plenty of helpful information here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you in your sweat!
Thank you so much for your incredibly kind words and especially for sharing the site with your friends and on Delicious! That truly means the world to me. I’m really glad you’re finding the information helpful, and it’s motivating to know that the effort put into the content is appreciated. Readers like you make it all worthwhile! Hope you and your friends continue to find value here. 😊
Warm regards